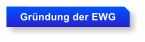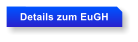Europa: JA - aber
welches?

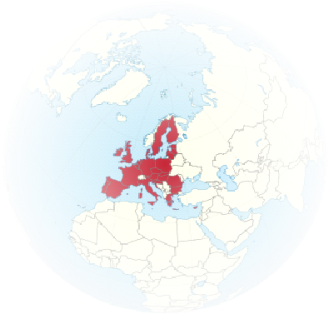
Die Europäische Union steckt in der tiefsten Krise ihres Bestehens. Die
Europa-Begeisterung, die es in den Anfangsjahren der EU durchaus gegeben
hat, hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer allgemeinen
Skepsis, ja sogar einer breiten Ablehnung bei den Unionsbürgern entwickelt.
Warum ist es so weit gekommen? Was sind die Gründe und Hintergründe
dieser Entwicklung? Und: ist diese Kritik und Ablehnung berechtigt?
Und vor allem: wie kann man dem entgegenwirken? Wie sollte man die Europä-
ische Union verändern und reformieren, damit sie wieder mehr Zustimmung bei
der Bevölkerung und den einzelnen Mitgliedsstaaten bekommt?
Zuerst einmal: das Volk erkennt letztendlich immer, ob eine Regierung – egal
ob König oder Parteien und Politiker - gut (= das heißt gerecht und dem Allge-
meinwohl dienend) regiert, oder ob sie so ihre Machtposition ausübt, dass dies
nicht dem Allgemeinwohl und der Bevölkerung zugute kommt (sondern haupt-
sächlich dem eigenen Machterhalt - auf Kosten und Unterdrückung der Bevöl-
kerung). Schon alleine deshalb kann man annehmen, dass die allgemeine
Unzufriedenheit mit der EU nicht unbegründet ist.
Dass unsere Regierungen und Politiker nicht zum Wohle der Bevölkerung
regieren, kann man aber auch daran erkennen, dass der Lebensstandard in den
letzten Jahren stetig abgenommen hat. Die europäischen Staaten sind über-
schuldet, die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie noch nie, Löhne sinken, während
die Lebenserhaltungskosten (angefangen bei der Miete bis zu den Lebens-
mittelpreisen) gleichzeitig immer mehr steigen. Und während die Armen immer
ärmer werden, werden die Reichen immer reicher ...
Die meisten geben Brüssel an diesem „Niedergang“ von Europa Schuld - und
der Tatsache, dass die EU ein grundlegendes Demokratiedefizit hat.
Aber: wie kann man dieses beheben? Viele meinen, die Integration innerhalb
der EU müsste stärker vorangetrieben werden, andere wollen die Kompetenzen
des Europäischen Parlaments erweitern.
Dieter Grimm, ehemaliger Richter und Professor em. für Öffentliches Recht an
der Humboldt-Universität in Berlin, hält das für den falschen Weg. In seinem
Buch „Europa ja – aber welches?“ nennt er die Gründe dafür.
Kritik am EuGH und den EU-Verträgen
Dieter Grimm sieht die Hauptquelle des europäischen Legitimationsdefizits in
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und in der „Konstitutio-
nalisierung“ der EU-Verträge.
Er begründet dies folgendermaßen: „Entscheidungen von hohem politischen
Gewicht werden in einem unpolitischen Modus getroffen. Dazu konnte es kom-
men, weil die exekutiven und judikativen Institutionen der EU sich von den
demokratischen Prozessen in den Mitgliedsstaaten wie in der EU selbst weit-
gehend entkoppelt haben. Die Möglichkeit dazu verdanken sie der „Konstitutio-
nalisierung“ der Verträge, der am wenigsten bemerkten Quelle des europäi-
schen Legitimationsdefizits. Die demokratische Legitimation wird sich daher
nur durch eine Repolitisierung der europäischen Entscheidungsprozesse
wiedergewinnen lassen.“
Was ist damit gemeint? Um das besser zu verstehen, muss man bedenken,
dass die Grundlage der heutigen EU die EWG (Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft) war, siehe ...
Von den großen Plänen für eine Integration der europäischen Staaten auf
politischer Ebene blieb also nur die wirtschaftliche Integration. Diese war kein
geeignetes Objekt für Begeisterung, aber ebenso wenig für Protest. Dieter
Grimm: „Sie bewahrte Europa einen breiten Zuspruch, weil sie unauffällig vor
sich ging, sich unpolitisch gab und zum Wohlstand beitrug. Das lag durchaus
in der Absicht der Gründer. Ein gemeinsamer Markt war nicht auf demokrati-
sche Legitimation angewiesen. Er legitimierte sich durch seinen Nutzen. Die
Politik blieb Sache der Staaten.“ (…)
So jedenfalls schien es. Die Rechtsgrundlage der EWG war ein völkerrecht-
licher Vertrag souveräner Staaten, ihr Leitungsorgan und Gesetzgeber der Rat,
in dem die Regierungen dieser Staaten saßen.
„Ratsentscheidungen verlangten Einstimmigkeit. Niemand konnte übergangen
werden. Die Kommission wurde von den Mitgliedsstaaten gebildet, war in ihrer
Tätigkeit aber von ihnen unabhängig und nur dem Integrationsprogramm ver-
pflichtet, das sie nach den rechtlichen Vorgaben der Staaten vorantreiben
sollte. Eine Volksbeteiligung war nicht vorgesehen. Es gab nur eine kompe-
tenzlose Parlamentarische Versammlung, die aus Abgeordneten der nationalen
Parlamente bestand. Die demokratische Legitimation der EU kam allein von
den ihrerseits demokratischen Mitgliedsstaaten.
Dass bei dieser wirtschaftlichen Integration aber auch weiterhin die politische
nicht aus den Augen verloren wurde – und auch heimlich weiter vorange-
trieben wurde - blieb vorerst vielen verborgen.
Warum? Weil die Fortschritte der Integration hauptsächlich von dem europä-
ischen Organ ausgingen, von dem sie seiner Aufgabe nach am wenigsten zu
erwarten waren: dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).
Er war es, der die INTEGRATION – von vielen unbemerkt – juristisch voran-
trieb. U.a. mit zwei umwälzenden Urteilen 1963 und 1964, siehe…
Die Urteile waren umwälzend, weil das so in den Verträgen nicht vereinbart
worden war, auch wohl kaum vereinbart worden wäre.
Der Vorgang ist nicht ohne Grund als „Konstitutionalisierung“ der Verträge
gedeutet worden ...
Durch die extensive Interpretation der Verträge seitens des EuGH gibt es ne-
ben der ausdrücklichen Kompetenzübertragung auf die EU auch einen schlei-
chenden Kompetenzverlust für die Mitgliedsstaaten.
Normalerweise setzt die Kompetenzübertragung auf die EU einen Willensent-
schluss der Mitgliedsstaaten voraus, der mit den nationalen Verfassungen
vereinbar sein muss.
Da die nationalen Verfassungen jedoch vom EuGH nicht berücksichtigt
werden, wird ein fundamentaler Grundsatz der Verträge, das Prinzip der
begrenzten Einzelermächtigung, dadurch unterhöhlt.
Klagen der Mitgliedsstaaten gegen diese Rechtsprechung sind jedoch wenig
aussichtsreich. Denn, wenn die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen einen Mitgliedsstaat, der sein Recht nicht aufgeben oder eine öffentliche
Einrichtung nicht abschaffen wollte, einleitete, konnte sie mit einem Sieg beim
EuGH rechnen. Ein Mitgliedsstaat hingegen, der Nichtigkeitsklage gegen die
Kommission wegen Kompetenzüberschreitung erhob, musste sich dagegen
auf eine Niederlage gefasst machen.
Der frühere Bundespräsident Herzog hat deswegen vor einiger Zeit dazu
aufgerufen, den EuGH zu stoppen. Doch es ist nicht so leicht, ein Gericht zu
stoppen …
Trotzdem: Warum haben die Mitgliedsstaaten dem keinen Einhalt geboten –
denn wenn schon ihre Klagen nicht aussichtsreich waren, so bildeten ihre
Regierungen doch im Rat den Gesetzgeber der Union, ursprünglich sogar den
Alleingesetzgeber, heute immer noch den Hauptgesetzgeber …
Zusammenfassung der Gründe für das
Demokratiedefizit in der EU
Die Unterscheidung zwischen Bedingungen für politische Entscheidungen und
diesen Entscheidung selbst ist für den Konstitutionalismus konstitutiv. In der
EU werden die beiden Ebenen aber vermischt.
Die Verträge sind voll von Vorschriften, die im Staat dem sogenannten ein-
fachen Recht zugehören würden. Ihre Auslegung und Anwendung durch die
Kommission und den EuGH ist daher Verfassungsvollzug. Infolgedessen
werden der Rat und die Parlamente nicht nur nicht für die Herstellung des
Gemeinsamen Marktes benötigt. Sie können die Entscheidungen der exeku-
tiven und judikativen Organge auch nicht durch Gesetzgebung ändern.
Eine Möglichkeit, die im Staat stets besteht, nämlich die Umsteuerung der
Gerichte durch Gesetzesänderung, fällt in der EU weitgehend aus. Der EuGH
ist freier als jedes nationale Gericht.
Lösungs- und Reformmöglichkeiten
Eine Änderung der Rechtssprechung könnte nur durch Änderung der Verträge
herbeigeführt werden.
Das eigentliche Demokratieproblem - und die fehlende Akzeptanz in der
Bevölkerung – der EU sieht Grimm vor allem in dem Umstand, dass Ent-
scheidungen von hohem politischen Gewicht in einem unpolitischen Modus
fallen. Damit ist gemeint, dass Kommission und EuGH bei vielen politischen
Entscheidungen unter sich bleiben.
Die Aufwertung des EU-Parlaments hat zum Beispiel nichts daran geändert,
dass die Kommission bei ihren Entscheidungen vom Ausgang der Parlaments-
wahlen unabhängig ist.
Das eigentliche Demokratieproblem der EU liegt daher in der Verselbständi-
gung der exekutiven und judikativen Organe von den politischen Organen der
EU und von dem Willen der Mitgliedsstaaten.
Grimm: „Verschärft wird es durch eine Schere, die sich zwischen Entschei-
dungsbefugnis und Verantwortlichkeit auftut. Sie ergibt sich daraus, dass die
EU ihre Entscheidungen mangels eines eigenen Verwaltungsunterbaus nicht
selbst umsetzen kann, sondern dafür auf die mitgliedsstaatlichen Regierungen
angewiesen ist.
Während die entscheidungsbefugte Kommission nicht demokratisch verant-
wortlich gemacht werden kann, können die nationalen Regierungen inner-
staatlich zur Verantwortung gezogen werden, haben aber nicht entschieden.
Dennoch werden sie demokratisch in Haft genommen, während bei der gegen
Bürgerproteste immunisierten Kommission nur ein diffuser Unmut ankommt.
Der EuGH fällt als Gericht aus dem demokratischen Verantwortungszu-
sammenhang ohnehin heraus.
Mehr zum Europäischen Gerichtshof siehe ....
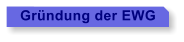




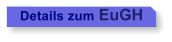
Elisa, 24.8.2016
Quellenangabe:
Dieter Grimm, “Europa ja - aber welches?”,
Verlag C.H.Beck oHG, München 2016