
Veronika von Jerusalem
Veronika ist eine bekannte, viel verehrte Heilige der
katholischen Kirche, die Christus bei seinem Kreuzweg, der
Überlieferung nach, das Schweißtuch gereicht hat. Das Fest der
Heiligen Veronika von Jerusalem wird am 4. Februar gefeiert.
Auf Kathpedia finden wir folgende Information: Zur
Biographie der Heiligen ist weiter nichts Sicheres bekannt.
Möglicherweise wurde die Heilige am Beginn "Beronike"
genannt, die makedonische Form von "Pherenike". Dieses
griechische Wort bedeutet "Siegbringerin". Später wurde sie
dann Veronika genannt. Der Name "vera ikon" (zusammen-
gesetzt aus griechischer und lateinischer Sprache) bedeutet
"Das wahre Antlitz" (vgl. Antlitz Christi).
Näheres zur Entstehung dieses heiligen Tuches mit dem Antlitz
Jesu und zur Person und dem Leben der hl.Veronika finden wir
allerdings bei der Heiligen Anna Katharina Emmerich. In
ihren Visionen sah sie folgendes über diese Begebenheit
während des Kreuzwegs unseres Erlösers:
“Beinahe zweihundert Schritte hatte Simon dem Herrn
geholfen, die Kreuzeslast zu tragen, als aus einem zur Linken
der Straße liegenden schönen Haus, zu dessen Vorhof mit
breiter Mauer und blinkendem Gitter eine Terrasse mit
Treppen führte, eine große, ansehnliche Frau mit einem
Mägdlein an der Hand dem Zuge entgegenstürzte. Es war
Seraphia, das Weib Sirachs, eines Mitgliedes aus dem
Tempelrat, welche durch ihre heutige Handlung den Namen
Veronika, von vera icon (das wahre Bild), erhielt.
Seraphia hatte zu Hause einen köstlichen gewürzten Wein
bereitet mit der frommen Begierde, den Herrn auf seinem
bitteren Leidensweg damit zu erquicken. Sie war in schmerz-
licher Erwartung dem Zuge schon einmal entgegengeeilt, ich
sah sie verschleiert mit einem jungen Mägdlein, das sie an
Kindes Statt angenommen , an der Hand neben dem Zug
schon hereilen, als Jsus seiner heiligen Mutter begegnete. Sie
fand in dem Getümmel aber keine Gelegenheit, und so eilte
sie dann nach ihrem Haus zu, den Herrn zu erwarten.
Sie trat verschleiert in die Straße, ein Tuch hing über ihrer
Schulter, das Mägdlein, etwa neun Jahre alt, stand neben ihr
und hatte die mit Wein gefüllte Kanne unter einem Überhand
verborgen, als der Zug sich näherte. Die Vorausziehenden
versuchten vergebens, sie zurückzuweisen. Sie war von Liebe
und Mitleid außer sich, sie drang mit dem Kind, das ihr
Gewand faßte, durch das zur Seite laufende Gesindel, durch
die Soldaten und Schergen hindurch, trat Jesus in den Weg,
fiel auf die Knie und hob das Tuch, an einer Seite ausge-
breitet, zu ihm auf mit den flehenden Worten: “Würdige
mich, meines Herrn Antlitz zu trocknen!”
Jesus ergriff das Tuch mit der Linken und drückte es mit der
flachen Hand gegen sein blutiges Angesicht und dann, die
Linke mit dem Tuche gegen die Rechte bewegend, welche
über den Kreuzarm herüberfaßte, drückte er das Tuch
zwischen beiden Händen zusammen und reichte es ihr
dankend zurück.
Sie aber küßte es und schob es unter den Mantel auf ihr Herz
und stand auf; da hob das Mägdlein das Weingefäß
schüchtern empor, aber das Schimpfen der Schergen und
Soldaten gstatteten es nicht, dass sie Jesus erquickte. Nur die
rasche Kühnheit ihrer Handlung hatte durch den Zudrang
des Volkes um das plötzliche Ereignis eine Stockung von
kaum zwei Minuten in den Zug gebracht, wodurch die
Darreichung des Schweißtuches möglich ward. Die reitenden
Pharisäer aber und Schergen ergrimmten über diesen
Aufenthalt und noch mehr über die öffentliche Verehrung
des Herrn und begannen Jesus zu schlagen und zu zerren,
und Veronika floh mit dem Kind in ihr Haus.
Kaum hatte sie ihr Gemach betreten, als sie das Schweißtuch
vor sich auf den Tisch legte und ohnmächtig niedersank, das
Mägdlein kniete jammernd mit dem Weinkrug bei ihr. So
fand sie ein Hausfreund, der zu ihr eintrat, und sah sie bei
dem ausgebreiteten Tuch, auf dem das blutige Angesicht Jesu
schrecklich, aber wunderbar deutlich abgedrückt war, wie tot
liegen. Er war ganz entsetzt, weckte sie und zeigte ihr das
Angesicht des Herrn. Sie war voll Wehklage und Trost und
kniete vor dem Tuch und rief aus: “Nun will ich alles
verlassen, der Herr hat mir ein Andenken gegeben.”
Dieses Tuch war eine etwas dreimal so lange wie breite Bahn
feiner Wolle, sie trugen es gewöhnlich um den Nacken
hängend, manchmal ein zweites über die Schulter nieder; es
war eine Sitte, Trauernden, Weinenden, Mühseligen,
Kranken, Ermüdeten damit entgegenzutreten und ihnen das
Angesicht damit zu trocknen; es war ein Zeichen der Trauer
und des Mitleids. Man beschenkte sich in heißen Ländern
damit. Es hat dieses Tuch nachher immer zu Häupten ihres
Lagers gehangen. Es ist nach ihrem Tode durch die heiligen
Frauen an die Mutter Gottes und durch die Apostel an die
Kirche gekommen.
Seraphia war eine Base des Täufers Johannes, denn ihr Vater
war der Sohn von dem Bruder des Vaters Zacharias. Sie war
von Jerusalem. (....) Seraphia heiratete spät, ihr Mann Sirach,
ein Nachkomme der keuschen Susanna, war in dem
Tempelrat. Da er anfangs Jesus sehr abgeneigt war, hatte
Seraphia wegen ihres innigen Zusammenhanges mit Jesus
und den heiligen Frauen vieles von ihm zu leiden. Ja, er hat
sie sogar mehreremal längere Zeit in einem Gewölbe
eingesperrt. Durch Joseph von Arimathäa und Nikodemus
bekehrt, ward er milder gesinnt und ließ es seiner Frau zu,
Jesus zu folgen. In dem Gericht über Jesus bei Kaiphas (...)
erklärte er sich mit Nikodemus, Joseph von Arimathäa und
allen Wohlgesinnten für unseren Herrn und schied mit
diesen von dem Synedrium aus.
Seraphia ist noch eine schöne, stattliche Frau, aber sie muß
doch über fünfzig Jahre alt sein. - Bei dem triumphierenden
Einzug Jesu in Jerusalem, den wir am Palmsonntag feiern,
sah ich sie mit einem Kind auf dem Arm unter andern Frauen
ihen Schleier vom Haupt nehmen und ihn in freudiger
Verehrung am Wege hinbreiten. Es war dasselbe Tuch, das
sie jetzt in einem traurigen, aber siegreichen Triumphzug
dem Herrn entgegenbrachte, die Spuren seines Leidens damit
zu sänftigen, derselbe Schleier, der seiner mitleidigen
Besitzerin den neuen, triumphierenden Namen Veronika gab
und jetzt in der öffentlichen Verehrung der Kirche ist.”
(Anna Katharina Emmerich, “Das bittere Leiden unseres Herrn Jesus
Christus”, S. 236ff.)
Anna Katharina Emmerich sah aber noch mehr Details aus dem Leben
der hl.Veronika, und auch ihren Märtyrertod:
“Im dritten Jahre nach Christi Himmelfahrt sandte der
römische Kaiser einen seiner Leute nach Jerusalem,
Zeugnisse über alle Gerüchte über Jesu Tod und
Auferstehung zu sammeln. Dieser Mann brachte den
Nikodemus, die Seraphia und einen Verwandten der Johanna
Chusa, den Jünger Epaphras , mit nach Rom (....)
Ich sah Veronika bei dem Kaiser, er war krank, sein Lager
war auf ein paar Stufen erhöht (....) Der Kaiser war allein,
seine Leute waren in der Vorstube. Ich sah, dass Veronika
außer dem Schweißtuch noch ein anderes Tuch von den
Grabtüchern Jesu bei sich hatte, und dass sie das
Schweißtuch vor dem Kaiser ausbreitete. (...)
Ich sah nicht, dass der Kaiser mit diesen Tüchern berührt
ward oder sie anrührte… Er ist aber durch ihren Anblick
gesund geworden. Er wollte Veronika in Rom behalten und
ihr zum Lohn ein Haus und Güter und gute Dienstleute
geben, aber sie verlangte nichts, als wieder nach Jerusalem
zurückzukehren und zu sterben, wo Jesus gestorben.
Ich sah auch, dass sie mit ihren Gefährten dahin
zurückkehrte, und dass sie in der Verfolgung der Christen in
Jerusalem, als Lazarus mit seinen Schwestern ins Elend
vertrieben war, mit einigen anderen Frauen entfloh, aber
eingeholt in einen Kerker gesperrt ward, in welchem sie als
Märtyrerin der Wahrheit, für Jesus, den sie oft mit irdischen
Brote, und der sie mit seinem Fleisch und Blut zum ewigen
Leben gespeist hatte, den Hungertod starb.
Ich erinnere mich im allgemeinen einmal gesehen zu haben,
wie das Schweißtuch der Veronika nach ihrem Tode bei den
heiligen Frauen blieb, wie der Jünger Taddäus es mit nach
Edessa nahm, und dort und anderwärts viele Wunder damit
tat, wie es auch in Konstantinopel war, und durch die Apostel
an die Kirche gekommen ist.” (Anna Katharina Emmerich, “Das
bittere Leiden unseres Herrn Jesus Christus”, S. 374ff.)
Soweit die Visionen der seligen Anna Katharina Emmerich. Auf
Kathpedia finden sich noch folgende Informationen zum
Schweißtuch der Veronika:
Der Kunsthistoriker Heinrich Pfeiffer SJ ist nach über
zwanzigjähriger Forschung zum Schleier von Manoppello
überzeugt, dass es sich bei genau diesem Tuch um das
eigentliche Sudarium bzw. das Schweißtuch der Veronika (von
lat./griech.: vera eicon = wahres Bild, s.o.) handelt, der einst
wichtigsten und meistverehrten Reliquie der Christenheit.
Nach (noch) offiziellem Brauchtum befindet sich das, seit dem
Jahr 708 in Rom (vielleicht in der päpstlichen Kapelle des
Lateran?) sicher bezeugte Tuch in der als mächtiger Tresor zu
diesem Zweck angelegten Kapelle innerhalb des Veronika-
pfeilers im "neuen" Petersdom, der über dem Grundstein der
konstantinischen Kirche errichtet wurde. Auf diesem fast
schwarz gewordenen Tuch ist allerdings nichts mehr zu
erkennen. P. Pfeiffer kommt aufgrund ikonographischer
Untersuchungen zu dem Schluss, dass das Schweißtuch der
Veronika schon seit dem Sacco di Roma 1527, oder spätestens
seit dem Abriss der alten Petersbasilika (in dem es bereits eine
Veronika-Kapelle gab) 1608, verschwunden und durch ein
anderes Tuch ersetzt worden sei. Vom Vatikan wurde diese
bereits früher laut gewordene Vermutung allerdings nie
bestätigt.
Nach der örtlichen Überlieferung wurde das Volto Santo bereits
1506 von einem Unbekannten nach Manoppello gebracht.
Wirklich bezeugt ist es dort jedoch erst seit dem Jahr 1638, als
es den Kapuzinern übergeben wurde.
Quellenangabe:
Anna Katharina Emmerich, “Das bittere Leiden unseres Herrn
Jesus Christus”, 1996, Christiana-Verlag
sowie Kathpedia
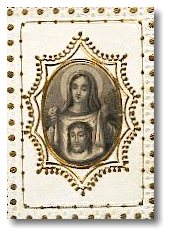
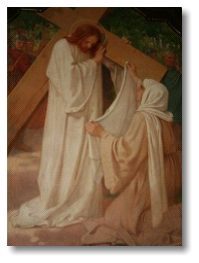
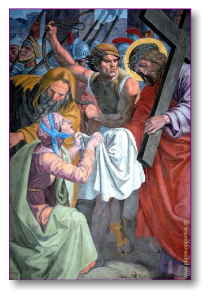
6.Station auf dem Kreuzweg,
Veronika und Jesus
(Kirche St.Nepomuk, Wien 2.)

Heilige Veronika, Petersdom










