
International Scientific
Optical Network
Das International Scientific Optical Network (ISON) ist eine Gruppe von
ungefähr 20 astronomischen Observatorien (= Sternwarte) in zehn Ländern.
Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, Objekte im Weltall aufzuspüren. Es wird
geleitet vom Keldysch-Institut für Angewandte Mathematik (russisch: Институт
прикладной математики им. М.В.Келдыша), das zur Russischen Akademie der
Wissenschaften gehört.
Zu den Entdeckungen dieser Organisation gehören die Kometen C/2010 X1
(Elenin) und C/2012 S1 (ISON). Letzterer wurde nach der Abkürzung des
Beobachtungsnetzwerks benannt.
Eine Sternwarte oder ein astronomisches Observatorium (von lat. observare =
beobachten) ist ein Ort mit wissenschaftlichen Instrumenten zur Beobachtung des
Sternhimmels. Neben einzelnen Himmelskörpern des Sonnensystems und unserer
Galaxis (Sterne, Sternhaufen, Nebel) sind zunehmend extragalaktische
Himmelsobjekte Ziel der Beobachtung sowie zugehörige Datenbanken und
theoretische Arbeiten.
Die Observatorien, von denen es weltweit einige hundert gibt, sind im Regelfall
auf erhöhten Standorten errichtet und mit einer Kuppel vor Wettereinflüssen
geschützt. Bei der Auswahl der Örtlichkeit ist eine möglichst große Zahl klarer
Nächte, wenig Störlicht und eine geringe Luftunruhe wesentlich. Letztere ist dort
gegeben, wo (insbesondere im Gebirge) laminare Luftströmungen vorherrschen.
Die Beobachtungen bzw. Messungen erfolgen zumeist mit Teleskopen (Linsen-
bzw. Spiegelfernrohren) oder Astrografen, heute zunehmend auch mit Antennen
(Radioastronomie), und in der Astrometrie (Positionsastronomie) mit
Transitinstrumenten. Die meisten Observatorien beobachten im sichtbaren Licht,
wobei die früheren visuellen Methoden weitgehend durch fotografische und
optoelektronische ersetzt wurden.
Bis etwa 1620 waren Observatorien fast ausschließlich für die freiäugige
Beobachtung des Himmels eingerichtet, ausgestattet mit Meridiankreisen oder
Sextanten, Armillarsphären, Gnomon oder großen Sonnenuhren (siehe auch
Astronomische Phänomenologie). Bei der wissenschaftlichen Tätigkeit dominierte
seit Jahrtausenden die Astrometrie, die erst ab 1850 durch die Astrofotografie und
die Astrophysik ergänzt (und vorübergehend in den Hintergrund gedrängt) wurde.
Heute konzentriert sich die Arbeit von höher gelegenen Observatorien zunehmend
auf nicht-visuelle Strahlungsbereiche wie nahes Infrarot, UV und Radiostrahlung,
während die kürzeren Wellenlängen (UV- und Röntgenstrahlen) großteils den
Weltraumteleskopen vorbehalten bleiben. Auch Observatorien auf dem Mond sind
in Planung.
Des Weiteren gibt es Privatsternwarten, die von einzelnen Amateurastronomen
oder Vereinigungen betrieben werden. In Einzelfällen oder an sogenannten
Astronomietagen bieten sie ebenfalls der Öffentlichkeit oder der Nachbarschaft
Sternführungen an. Viele Beobachtungsplätze sind auf Wohnhäusern eingerichtet
und mit kleinen Kuppeln oder einem Schiebedach bzw. Rolldach geschützt.
Andere sind – insbesondere bei transportablen Fernrohren – als Terrassen- oder
Gartensternwarte ausgeführt.
Sozialrechtlich sind die Nachtdienste der Astronomen durch spezielle Vergütungen
und einvernehmliche Dienstpläne geregelt, doch ist der Prozentsatz der nötigen
Nachtarbeit durch die Möglichkeiten der automatischen Teleskopsteuerung und
des Internet deutlich im Sinken begriffen.
Antike und Mittelalter
Die derzeit als ältestes datiertes Observatorium der Vorgeschichte geltende Anlage
ist eventuell die Kreisgrabenanlage von Goseck aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. Der
Megalith-Kreis in Nabta-Playa in der Nubischen Wüste könnte auch in diese Zeit
fallen.
Andere Anlagen stammen aus Zeiten ab ca. 3000 v. Chr. (Stonehenge) oder der
Boitiner Steintanz ca. 1200 v. Chr. Das Cheomseongdae-Observatorium in
Korea ist das älteste im Fernen Osten. China hat eine lange Tradition im Bau von
Observatorien.
In der Tang-Dynastie wurden 20 Sonnenobservatorien für die Erstellung des Da
Yan Kalenders 729 A.D. errichtet, wobei 10 Observatorien entlang des 114.
Grades östlicher Länge von Zentralasien bis Huế verteilt wurden, um die
Kugelgestalt der Erde zu überprüfen. Die Yuan-Dynastie ließ für den Shou Shi
Kalender 1281 27 Großobservatorien erbauen, wobei das Gaocheng-
Observatorium nahe Dengfeng in der Provinz Henan noch gut erhalten ist. In Peru
befindet sich das 2300 jahre alte Chanquillo-Observatorium, das aus 13 Türmen
auf einem Berggrat besteht.
Im Spätmittelalter und der Zeit danach entstanden die ersten Vorläufer der
„klassischen“ Sternwarten. Sie beheimateten Instrumente zur Vermessung von
Sternörtern, z. B. Quadranten oder Astrolabien, oder große Sonnenuhren. Beispiele
sind das Observatorium Rasad-e Khan von Nasir Al-din al-Tusi, die Sternwarte des
Ulug Beg, Uraniborg und Stjerneborg, die Sternwarten Tycho Brahes oder die
Jantar Mantars des Maharajas Jai Singh II.
Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie
Sternwarte
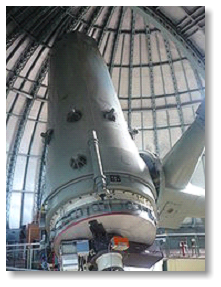
Modernes 2-Meter-Spiegelteleskop
des Observatoire de Haute-Provence

Universitätssternwarte Wien

Klassische Sternwartekuppel:
Großer Refraktor der Universitäts-
sternwarte Wien von 1885,
11 m Brennweite

Ein ganzer „Sternwarten-Campus“ auf La Palma,
Roque-de-los-Muchachos-Observatorium


Megalith-Observatorium in
Nabta-Playa
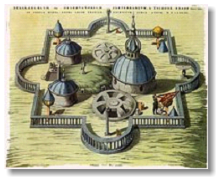
Stjerneborg






