
Ökoeffektivität
Ökoeffektivität ist ein Begriff, den der deutsche Chemiker Michael Braungart und
der US-amerikanische Architekt William McDonough in ihrem 2002 erschienenen
Buch Cradle to Cradle (C2C, Von der Wiege bis zur Wiege) verwenden. Sie
stellten den Begriff in Kontrast zur Ökobilanz (die den Stoffkreislauf und dessen
Umweltwirkungen von der Wiege bis zur Bahre analysiere) und zur Ökoeffizienz.
Ökoeffektiv sind nach Braungart und McDonough Produkte, die entweder als
biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können
oder als „technische Nährstoffe“ kontinuierlich in technischen Kreisläufen
gehalten werden.
Das Prinzip für einen ökoeffektiven Lösungsansatz laute: Abfall ist Nahrung
(waste equals food). Bei vielen natürlichen Prozessen werde sowohl Energie als
auch Material verschwendet. Pflanzen und Tiere produzierten große Mengen
„Abfall“. Sie sind nicht ökoeffizient. Sie seien gleichwohl ökoeffektiv, weil sie
Teil eines nachhaltigen Systems sind, das jedes Stück Abfall wiederverwendet,
zum Beispiel als Dünger.
Analog dazu könne eine technische Produktion effektiv sein, wenn sie Stoffe
abgibt, die in anderen Produktionen einsetzbar sind.
Beispiele für Ökoeffektivität
-
Emissionen einfangen und für neue Produkte oder Brennstoffe verwenden
(Upcycling).
-
Bremsbeläge aus einem Material herstellen, das unbedenklich in biologische
Kreisläufe zurückgeführt werden kann (biologische Abbaubarkeit).
-
Kunststoffprodukte gezielt so entwickeln, dass sie demontiert und recycelt
werden können.
-
Energiequellen nutzen, die direkt von der Sonne stammen (erneuerbare
Energie).
-
Das Gesamtprodukt auf biologische oder technische Kreisläufe abstimmen
(Kreislaufwirtschaft).
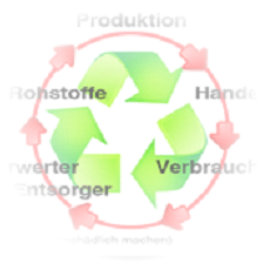
."Öko-Effizienz bedeutet, giftige Substanzen sparsam zu verwenden und am Ende zu
deponieren. Öko-Effektivität bedeutet, mit ungiftigen Substanzen verschwenderisch
umzugehen und sie in Kreisläufen zirkulieren zu lassen. Eben so, wie es die Natur uns
vormacht."
Praktisch schlägt Braungart zwei getrennte Kreislaufsysteme vor: den biologischen
Kreislauf und den technischen Kreislauf.
Im biologischen Kreislauf zirkulieren die natürlich abbaubaren Substanzen -
Materialien, die im weitesten Sinne essbar sind. Dazu zählt Braungart neben den
primären Lebensmitteln die Verpackungen, die wir dann bedenkenlos in die
Landschaft werfen könnten, weil sie verrotten und der Natur als Nahrung dienen.
Hierzu zählen aber auch Textilien oder Möbelbezüge, deren Abrieb wir in Form von
Mikropartikeln permanent einatmen, also letztlich verzehren.
Als Richtschnur für biologische Kreisläufe definiert Braungart, ob sich eine Substanz
in der Muttermilch anreichert oder ob sie abgebaut wird. Davon sind wir heutzutage
weit entfernt: "Es gibt in allen OSZE-Ländern seit siebzehn Jahren keine einzige
Muttermilchprobe, die als Trinkmilch vermarktet werden dürfte."
In den technischen Kreislauf gehören jene Stoffe, "die so konstruiert sind, dass sie in
den industriellen Kreislauf zurückkehren können, dem sie entstammen".
In einem gewöhnlichen TV-Gerät hat Braungart beispielsweise 4 360 Chemikalien
entdeckt. "Manche davon sind giftig, andere jedoch wertvolle Nährstoffe für die
Industrie, die verschwendet werden, wenn der Fernseher auf einer Mülldeponie
landet."
Dabei könnten sie intelligenterweise "in ihrer hohen Qualität innerhalb eines ge-
schlossenen industriellen Kreislaufs weiterzirkulieren". So kann "ein robustes
Computergehäuse fortwährend als robustes Computergehäuse zirkulieren - oder als ein
anderes hochwertiges Produkt, wie zum Beispiel als Autoteil oder medizinisches
Gerät", anstatt zur Schallschutzwand oder zum Blumentopf downgecycelt zu werden.
Vollends praktikabel wird der technische Kreislauf mit Braungarts Idee des "Dienst-
leistungsprodukts": Danach werden die Verbraucher ihre Produkte nicht mehr
kaufen, besitzen und beseitigen, sondern all jene Erzeugnisse, die wertvolle technische
Nährstoffe enthalten (beispielsweise technische Geräte und Auslegeware), als Service
in Anspruch nehmen. Die Kunden zahlen künftig für eine bestimmte Nutzerzeit, etwa
zehntausend Stunden TV, anschließend geben sie das Produkt an den Hersteller zu-
rück. Der zerlegt es dann und verwendet die Materialien für neue Produkte.
Alles nur Zukunftsmusik? Bloße Wachträume eines fantasiebegabten Öko-Visionärs?
Keineswegs. Auf Braungarts Kundenliste sind namhafte Adressen versammelt, darun-
ter Nike, BASF, Degussa, Volkswagen, Wella und Unicef.
Für den Chemiehersteller Dow Chemical hat Braungart eine Idee ersonnen unter dem
Motto: "Mieten Sie ein Lösungsmittel". Damit werden beispielsweise Schmierfette von
Maschinenteilen entfernt. Üblicherweise kaufen Unternehmen das billigste Lösungs-
mittel, selbst wenn sie es um den halben Erdball transportieren müssen. Nach Ge-
brauch lassen sie den Lösungsmittelabfall entweder verdunsten oder leiten ihn ins
Abwasser.
Die Braungart-Methode sieht einen Entfetter-Service mit hochwertigen Lösungs-
mitteln vor, ohne die Chemikalie selbst zu verkaufen. Der Serviceanbieter fängt die
Emissionen auf und trennt das Lösungsmittel vom Schmierfett, um es weiterhin zu
verwenden. Dies veranlasst einerseits den Anbieter, Lösungsmittel von hoher Qualität
zu benutzen, andererseits werden somit giftige Substanzen vom Abwasser fern
gehalten.
Mittlerweile interessiert sich auch der Chemieriese DuPont für dieses Konzept. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Sollte dieses System eines Tages konsequent eingesetzt
werden, würde kein unbrauchbarer, womöglich giftiger Abfall anfallen, die Hersteller
könnten Materialkosten in Millionenhöhe einsparen, und die Förderung von Roh-
stoffen könnte zunehmend aus dem Produktionsprozess verschwinden, da die Nähr-
stoffe für neue Produkte ständig zirkulieren. Dies bedeutet für die Hersteller noch mehr
Einsparungen. Der Umwelt käme es allemal zugute.
Als William Clay Ford jr., Chef der Ford Motor Company und Urenkel des
Gründers Henry Ford, im Mai 1999 bekanntgab, für zwei Milliarden Dollar die riesige
Produktionsanlage River Rouge in Dearborn, Michigan, umzubauen, erhielt Braungarts
Partner McDonough den Auftrag, diesen "Totalumbau zu einer Ikone der nächsten
industriellen Revolution" zu leiten.
"The Rouge" galt einst als ein Wunder der Arbeitsplanung und Wahrzeichen der
modernen Industrie. Als William Ford Konzernchef wurde, fand er das Gelände zu
einem Schrotthaufen verkommen vor. Erklärtes Ziel war, ein Firmenareal zu schaffen,
auf dem die Kinder der Arbeiter gefahrlos spielen konnten.
Am Beispiel des Regenwassermanagements wird deutlich, wie dies dem McDonough-
Team gelingt. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Wasserreinhaltung verlangten neue
Betonröhren und Aufarbeitungsanlagen, die das Unternehmen bis zu 48 Millionen
Dollar gekostet hätten. McDonough entschied sich stattdessen für eine öko-effektive
Lösung. Die neue Anlage wird Gründächer haben, die bis zu 50 Millimeter Regen-
wasser speichern, auf den Parkplätzen wimmelt es von Lochsteinen, die ebenfalls
Wasser aufnehmen. Von dort sickert das Regenwasser in einen Sumpf, wo es durch
Pflanzen, Mikroben, Pilze und andere Organismen gereinigt wird. Danach wird es
durch Gräben voller heimischer Pflanzen in den Fluss geleitet.
Drei Tage benötigt das Regenwasser für diesen Weg. Auf diese Weise wird Wasser
wie Luft gereinigt, Lebensraum geschaffen und die Landschaft verschönert. Das Unter-
nehmen spart obendrein eine Menge Geld - schätzungsweise bis zu 35 Millionen
Dollar.
Für den Kosmetik- und Reinigungsmittelkonzern Unilever renovierte er das
Duschgel CD, indem er die bisherigen 22 Inhaltsstoffe, zum Teil billigste Zutaten, auf
neun umso hochwertigere Inhaltsstoffe reduzierte. "Wir fragten uns: Was für ein
Waschmittel will der Fluss?" Zwar waren die neuen Chemikalien teurer als die alten,
trotzdem wurde der gesamte Produktionsprozess durch einfachere Zubereitung sowie
geringere Lageranforderungen um fast 15 Prozent billiger.
Für den weltgrößten Teppichbodenhersteller Shaw-Industries entwickelte Braungart
einen Zwei-Komponenten-Teppichboden, bestehend aus einer Verschleißschicht und
einer Verbleibschicht. "Die Verschleißschicht nehme ich raus und kann sie kompos-
tieren, die Verbleibschicht bleibt drin und kann mit einer neuen Verschleißschicht
bedeckt werden."
Für diese Idee erhielt Braungart den US-Green Chemistry Award 2003. In London
hat das Science Museum seinem Cradle-to-cradle-Konzept sogar eine komplette
Ausstellung gewidmet: "Smart designs look to the future", heißt es auf der entsprech-
enden Internetseite. "Unsere Zukunft wird nicht bloß im Abfall der Vergangenheit
versinken."
Gleichwohl setzen Braungarts Visionen ein grundlegendes Umdenken voraus, das
bislang nur mühsam vorankommt. Aber Braungart weiß, zu welchen psychischen Ver-
werfungen die jahrhundertelange Naturzerstörung im Menschen geführt hat. "Unsere
gesamte Umweltsprache ist eine Schuldsprache. Mir ist schon als Zivildienstleistender
in Altersheimen aufgefallen, wie sehr in unserer Gesellschaft mit schlechtem Gewis-
sen, mit Schuldzuweisungen die Leute kontrolliert und gebrochen werden. So läuft
auch die ganze Umwelt- und Mülldiskussion völlig moralisierend ab. Der ökologische
Fußabdruck, den der Mensch hinterlässt, solle möglichst klein sein - das ist eine ganz
und gar protestantische Lebenshaltung. Ich will das Gegenteil: Mein Fußabdruck soll
möglichst groß sein, denn ich möchte wichtig genommen werden. Nur soll dieser
Fußabdruck bitteschön in einem Feuchtgebiet sein."
Das gelingt jedoch nur in einem partnerschaftlichen Verhältnis des Menschen zu seiner
Umwelt. Also mit "ökologisch intelligenten Produkten", die, anstatt die Welt ein biss-
chen weniger zu zerstören, der Umwelt wohl tun.
Geht das überhaupt? Schadstoffe vermeiden anstatt sie bloß zu vermindern? Che-
mische Erzeugnisse, die biologisch so unbedenklich sind, dass wir sie essen können?
Verpackungen, die wir bedenkenlos in die Landschaft werfen können, weil sie
komplett zerfallen?
"Selbstverständlich gibt es das alles", sagt Peter Donath von Ciba. "Heute gibt es so
viele biologisch abbaubare Polymere - es wäre überhaupt kein Problem, Verpackungen
herzustellen, die in der Erde verrotten. Es ist nur kein Anreiz da, so etwas zu tun."
"Dabei müssten diese Leute in ihren Köpfen gar nicht so viel umbauen, meint Braun-
gart. "Sie müssten eigentlich nur etwas zulassen. Nämlich, dass das, was sie zwanzig
Jahre lang an Effizienz betrieben haben, eine gute Übung war für Effektivität. Eine
gute Übung, um zum Beispiel die Stoffströme einfach mal kennen zu lernen."
Mehr zu den revolutionären Visionen von Braungart sowie seinen Werdegang siehe
https://www.berliner-zeitung.de/michael-braungart-ist-ein-oeko-visionaer--seine-ideen-stellen-
alles-auf-den-kopf--was-wir-unter-umweltschutz-verstehen-die-klugheit-des-kirschbaums-
15592904
16.11.2017













