
Menschenrechtssituation in Nordkorea
Nordkorea (offiziell die „Demokratische Volksrepublik Korea“) zählt zu den
Unterzeichnerstaaten des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte sowie des Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
Dennoch beklagen die Vereinten Nationen, das Europäische Parlament und viele
Menschenrechtsorganisationen massive Verletzungen der Menschenrechte.
In vielen Rankings – etwa solchen, die den Grad der Demokratie oder die Presse-
freiheit eines Staates betreffen – liegt Nordkorea weltweit auf den letzten Plätzen.
Es gilt als das restriktivste aller heute existierenden totalitären Systeme.
Historisch-politischer Hintergrund
Die Gründe für die Entwicklung des heutigen politischen Systems in Nordkorea
gehen zurück in die Zeit der japanischen Kolonialherrschaft. Gegen Ende des
Zweiten Weltkrieges kamen US-amerikanische und sowjetische Truppen im
Kampf gegen Japan nach Korea. Im Norden der Koreanischen Halbinsel instal-
lierte die sowjetische Besatzungsmacht, wie in den osteuropäischen Staaten, ein
politisches System nach Vorbild der Sowjetunion unter Stalin. So hatten die Be-
wohner Nordkoreas auch nach Ende der japanischen Fremdherrschaft weiterhin
nahezu keine Möglichkeiten, ihre bürgerlichen und politischen Rechte wahrzu-
nehmen.
Durch die Sowjetunion unterstützt, installierte der Staatschef Kim Il-sung in der
1948 gegründeten Demokratischen Volksrepublik Korea ein Führersystem mit
einem Personenkult, der mit jenem um Stalin in der Sowjetunion vergleichbar ist.
Auch der staatliche Repressionsapparat wurde nach sowjetischem Vorbild aufge-
baut. Moskau entsandte Berater, die bis zum Ende der 1950er Jahre im nordkorea-
nischen Innenministerium tätig waren.
In den 1950er Jahren begann Kim Il-sung den Kampf gegen seine vermeintlichen
Gegner in der Partei und konsolidierte so seine unangefochtene Alleinherrschaft.
Das allgegenwärtige Klima des Misstrauens in dieser Zeit, die Hatz auf so genan-
nte Volksfeinde, verstärkte die Repression gegen die Bevölkerung weiter.
Eine ähnliche Wirkung hatte auch der andauernde Konflikt mit dem mit den USA
verbündeten Südkorea, der seinen Höhepunkt im Koreakrieg fand.
Die nordkoreanische Gesellschaft erfuhr während des Kalten Krieges eine durch-
greifende Militarisierung, die zu ständiger Alarmbereitschaft und, damit verbun-
den, zu einer andauernden Verfolgung vermeintlicher westlicher Agenten führte.
Die Bezichtigung der Spionage diente häufig als Vorwand für die Ausschaltung
politischer Gegner Kim Il-sungs und seines Sohnes. Eine Besonderheit Nordkoreas
war, dass es sich durch geschicktes Lavieren zwischen den kommunistischen
Großmächten China und Sowjetunion einem sowjetischen Einfluss in dem Aus-
maß, wie er in Osteuropa gegeben war, entziehen konnte.
Wichtigste Konsequenz hieraus in Bezug auf die Menschenrechte ist, dass das
nordkoreanische Regime sich dem Bruch mit dem Stalinismus und der folgenden
Milderung der übrigen realsozialistischen totalitären Systeme verweigerte.
Die auf Isolation ausgerichtete Politik des Regimes verhinderte auch ein
Übergreifen der Demokratiebewegungen des Jahres 1989.
Menschenrechtsverletzungen
Staatliche Diskriminierung als „politisch unzuverlässig“ eingestufter Bürger
Es wurde mehrfach berichtet, dass die Bevölkerung Nordkoreas durch die Staats-
führung in ein dreigliedriges Kastensystem eingeteilt wurde.
Dieses richtet sich nach der potenziellen Gegnerschaft gegenüber dem Regime. Es
wurde Ende der 1950er Jahre nach dem Vorbild eines Systems eingeführt, das in
der Volksrepublik China unter Mao Zedong existierte.
Die drei Gruppen des Systems sind die der „freundlich gesinnten Kräfte“, die der
„neutralen Kräfte“ und die der „feindlich gesinnten Kräfte“.
Zu den feindlich gesinnten Kräften, der untersten Klasse, zählen die Familien-
angehörigen von Nordkoreanern, die in den Süden übergelaufen sind, Unternehmer
und Geistliche aus vorsozialistischer Zeit und ihre Familien, ehemalige Angestellte
der japanischen Kolonialbehörden und ihre Familien, (ehemalige) Häftlinge und
ihre Familien sowie Parteimitglieder, die gegen die Herrschaft Kim Il-sungs
aufgetreten waren und deren Familien.
Zur bevorzugten Klasse der freundlich gesinnten Kräfte gehören Parteikader und
ihre Familien, sowie Familien von Gefallenen des Kampfes gegen die Japaner und
des Koreakrieges.
Angehörigen der untersten Klasse ist es seit Ende der 1950er Jahre verboten, sich
in größeren Städten und in der Nähe der Staatsgrenze und der Küsten aufzuhalten.
Es wurde auch berichtet, dass diese Gruppe seit der drastischen Verschärfung der
Versorgungslage in den 1990er Jahren keine Lebensmittelkarten oder sonstige
Zuwendungen des sozialistischen „Versorgungsstaates“ mehr erhält.
Einschränkung der Meinungsfreiheit
Das stalinistische System mit seinem Personenkult bringt es mit sich, dass jegliche
Abweichung von der quasi-religiösen Verehrung der politischen Führer Kim Il-
sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un bestraft wird.
Bereits ein unachtsamer Umgang mit dem Porträt einer der Führungspersönlich-
keiten kann strafrechtliche Konsequenzen haben, so wie jegliche Äußerung einer
Meinung, die nicht mit der Linie der herrschenden Partei der Arbeit Koreas verein-
bar ist oder gar deren Führungsanspruch in Frage stellt.
Einschränkung der Informationsfreiheit
Den Einwohnern Nordkoreas ist es nicht erlaubt, andere als die staatlichen nord-
koreanischen Medien, die von der staatlichen Propaganda durchdrungen sind, zu
nutzen.
Das Hören ausländischer Rundfunksender etwa wird hart bestraft. Ein Beispiel
dafür ist der Journalist Kang Chol-hwan, welcher noch rechtzeitig aus Nordkorea
flüchten konnte, wobei staatliche Organe dieser Straftat auf der Spur waren. Die
Nutzung des mobilen Internets ist für Nordkoreaner strafbar.
Einschränkung der Glaubensfreiheit
In der Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Korea ist das Recht auf freie
Religionsausübung festgeschrieben. Dies gilt mit der Einschränkung, dass sich
Religion nicht in politische Angelegenheiten einmischen dürfe.
Offiziellen Angaben zufolge gehöre eine Minderheit von etwa 0,2 % der Bevölker-
ung Religionsgemeinschaften an, meist dem Buddhismus oder dem Christentum.
Während der Buddhismus als ein kulturelles Erbe des Landes in gewisser Weise
geachtet wird, gilt das Verhältnis zum Christentum als belastet.
Die Regierung bringt den christlichen Glauben mit politischen Aktivisten, die von
den USA und Südkorea beeinflusst sind, in Zusammenhang. Menschenrechtsor-
ganisationen zufolge zählt Nordkorea zu den Ländern, in denen Christen am
stärksten verfolgt werden.
Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Menschen aufgrund ihres christlichen
Glaubens in Lagern interniert, gefoltert oder hingerichtet wurden. Es wird sogar
über mehrere öffentliche Hinrichtungen von Christen berichtet.
So soll beispielsweise die Christin Ri Hyon-ok am 16. Juni 2009 in Ryongchŏn
wegen Bibelverbreitung öffentlich hingerichtet worden sein, während ihr Ehemann
und ihre drei Kinder in das Konzentrationslager Haengyŏng deportiert wurden. Die
Hinrichtung erfolgte allerdings in Zusammenhang mit vorgeworfener Spionage-
tätigkeit für die USA und Südkorea, sowie der Beihilfe zu Republikflucht.
Zwischen 1949 und 1952 unter der Herrschaft Kim Il-sungs und im Verlauf des
Koreakrieges wurden alle Kirchen zerstört, die meisten Priester und Mönche
wurden hingerichtet oder starben in nordkoreanischen Internierungslagern.
Das Martyrium der Benediktinermönche in der ehemaligen Abtei Tokwon ist
beispielhaft dokumentiert, da für sie der Prozess der Seligsprechung eingeleitet
wurde. Seitdem gibt es keine Priester und keine christlichen Gemeinden mehr in
Nordkorea.
Einen Kontrast, dessen tatsächliche Relevanz in der westlichen Welt nicht geklärt
ist, bilden die in Pjöngjang errichteten Gotteshäuser. Vier Kirchen wurden seit
1988 mit ausländischen Spendengeldern errichtet, die vermutlich lediglich den
Anschein von Religionsfreiheit erwecken sollen, tatsächlich aber vor allem aus-
ländischen Besuchern vorgeführt werden.
Unter dem Einfluss des sich der Kirche immer stärker zuwendenden Russlands ist
im Jahr 2006 in Pjöngjang auch eine russisch-orthodoxe Kirche erbaut worden.
Offiziell wird das Christentum in Nordkorea durch die „Koreanische Christliche
Vereinigung“ repräsentiert.
Einschränkung der Bewegungsfreiheit
Die Bürger Nordkoreas sind nicht berechtigt, ihren Wohnort ohne behördliche
Erlaubnis zu verlassen. Darüber hinaus bestimmen die Behörden über den Wohn-
ort der Bürger. So ist bekannt, dass es politisch unzuverlässigen Bürgern ebenso
wie sichtbar Behinderten untersagt ist, sich etwa in Pjöngjang anzusiedeln.
Ferner werden Nordkoreaner, die unerlaubt die Staatsgrenzen übertreten, hart be-
straft. Für Nordkoreaner, die in China aufgegriffen und zurückgeschickt wurden,
gibt es spezielle Strafeinrichtungen.
Folter
Ehemalige Insassen von Gefängnissen und Straflagern berichten von der
allgemeinen Verbreitung von Foltermethoden im nordkoreanischen
Strafvollzugssystem.
Todesstrafe
Die Todesstrafe wird für zahlreiche Vergehen verhängt. Exekutionen finden häufig
öffentlich statt.
Menschenrechtsorganisationen haben Zeugenaussagen zu insgesamt 1193 Hin-
richtungen in Nordkorea gesammelt und dokumentiert, wobei die Dunkelziffer
weitaus höher liegen dürfte.
Für die Zeit von 2000 bis 2013 wurden vom staatlich finanzierten Korean Institute
for National Unification 1382 öffentliche Hinrichtungen gezählt. Der jährliche
Spitzenwert wurde demnach 2009 mit 160 Exekutionen erreicht.
Die Zahl der jährlichen Hinrichtungen soll aber 2014 erneut gestiegen sein. Für das
Jahr 2009 meldete Nordkorea selbst eine Hinrichtung und für 2014 zwei Hinrich-
tungen.
Menschenversuche
Mehrere nordkoreanische Flüchtlinge, aber auch Mitarbeiter internationaler Or-
ganisationen berichten davon, dass in Nordkorea systematisch neue Waffen, da-
runter chemische und biologische Waffen an Lagerhäftlingen und z. T. minder-
jährigen Behinderten getestet würden.
So würden etwa Gruppen von Menschen in einem geschlossenen Raum Giftgas in
tödlicher Dosis ausgesetzt, um dessen Effektivität zu testen. Diese Berichte aus
dem Jahr 2009 wurden 2014 und auch 2015 erneut erhoben.
2014 berichtete ein Mann, der bei einem Unfall eine Hand und einen Fuß verloren
hatte davon, wie Behinderte in Nordkorea als nicht existierend bezeichnet ohne
jede fremde Hilfe im Alltag auskommen müssten.
Dies wurde durch Berichte eines anderen Flüchtlings bestätigt, der von einem
Programm berichtete, nach dem behinderte Kinder den Eltern abgekauft würden,
mit dem Versprechen, sich um sie zu kümmern, wobei man sie in Wahrheit als
Testobjekte für Versuche mit Anthrax sowie chemischen Waffen missbrauche.
Im Juli 2015 erklärte ein Flüchtling, der sich nach unbestätigten Berichten in
Finnland aufhalten soll, dass er in einer Forschungseinrichtung in Ganggye ge-
arbeitet habe und dass er bei seiner Flucht große Mengen an Daten mitgenommen
habe, die die Menschenversuche belegen können. Diese Daten wollte er dem
Europäischen Parlament vorlegen.
Das System der Straflager
Das nordkoreanische Strafvollzugssystem mit seinen Straflagern und Gefängnissen
gliedert sich in zwei Teile: Die Internierungslager für politische Gefangene
(koreanisch Kwan-li-so) und die Umerziehungslager (koreanisch Kyo-hwa-so).
Internierungslager für politische Gefangene
Die Straflager, in denen politischer Vergehen beschuldigte oder politisch unzu-
verlässige Personen interniert sind, werden vom Staatssicherheitsministerium
betrieben.
Für politische Gefangene gilt das Prinzip der Sippenhaftung. Sie werden zusam-
men mit ihren Eltern, Kindern und Geschwistern, zuweilen sogar Großeltern und
Enkeln ohne Gerichtsverfahren und Verurteilung abgeholt und in die Straflager
deportiert, wo sie in der Regel den Rest ihres Lebens interniert bleiben.
Die Straflager befinden sich in der Mitte und im Nordosten von Nordkorea. Sie
bestehen aus zahlreichen Strafkolonien in abgelegenen und isolierten Bergtälern.
Die Gesamtzahl der Gefangenen wird auf um 200.000 geschätzt.
Die Lager Yodŏk und Pukch'ang sind in zwei Bereiche aufgeteilt: In einem Teil
leben die lebenslang internierten politischen Gefangenen, in einem anderen Teil
leben ähnlich wie in den Umerziehungslagern die zu langjährigen Haftstrafen ver-
urteilten Gefangenen mit der Hoffnung auf mögliche Entlassung.
Den Gefangenen wird Zwangsarbeit auferlegt, meist mit einfachen Mitteln in
Bergwerken oder der Landwirtschaft.
Unterernährung, Arbeitspensum und fehlende medizinische Betreuung führen zum
Tod zahlreicher Gefangener. Zudem weisen viele durch Arbeitsunfälle, Erfrierun-
gen oder Folter herbeigeführte Verstümmelungen auf.
Innerhalb des Lagers herrscht ein von Willkür geprägtes Bestrafungssystem. Zu
langsames Arbeiten und Ungehorsam werden in der Regel mit Misshandlungen
und Folter bestraft, Diebstahl, auch von Lebensmitteln, oder Fluchtversuche mit
öffentlichen Hinrichtungen.
Von ursprünglich über zwölf Straflagern wurden einige zusammengelegt und
geschlossen (unter anderem das Internierungslager Onsŏng, Kwan-li-so Nr. 12,
nach einem niedergeschlagenen Aufstand mit zirka 5000 Toten im Jahre 1987).
Ein ehemaliger Insasse des Straflagers Nr. 15 Yodŏk ist der südkoreanische
Journalist Kang Chol-hwan, der ein Buch über seine Zeit im Lager verfasste.
Das Schicksal eines geflohenen Sträflings von Straflager Nr. 14 Kaech'ŏn, Shin
Dong-hyuk, ist ebenfalls Gegenstand eines Buches, das auch verfilmt wurde.
2013 untersuchten die Vereinten Nationen erstmals die Straflager in Nordkorea. Es
wurden andauernder Hunger und Folter dokumentiert. Die nordkoreanische
Regierung warf der UNO Fälschungen und Umsturzversuche vor.
Umerziehungslager
Die Umerziehungslager für Kriminelle im konventionellen Sinn werden vom
Innenministerium betrieben. Der Übergang zwischen gewöhnlichen Verbrechen
und politischen Verbrechen ist fließend, da Menschen, die sich bei der Partei-
führung auf irgendeine Weise unbeliebt gemacht haben, häufig aufgrund falscher
Anschuldigungen denunziert werden. Sie werden dann in Untersuchungsgefäng-
nissen durch brutale Folter (Lee Soon-ok z. B. musste in Ch'ŏngjin immer wieder
bei Frost mit Wasser überschüttet eine Stunde niederknien mit anderen Gefange-
nen, von denen sechs nicht überlebten) zu Geständnissen gezwungen und in einem
kurzen Schauprozess zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
In Nordkorea sind politische Verbrechen sehr weit gefasst, sie reichen von Repu-
blikflucht bis zu jeglicher Störung der Staatsordnung und werden streng bestraft.
Wegen der schlechten Haftbedingungen, Hunger und Folter überlebt ein großer
Teil der Gefangenen ihre Haftstrafen nicht.
Die Umerziehungslager sind meist große, von hohen Mauern umgebene Gefäng-
niskomplexe. Die Situation der Gefangenen unterscheidet sich wenig von der in
den Lagern für politische Gefangene.
Sie müssen in gefängniseigenen Werkstätten harte Sklavenarbeit verrichten und
wenn sie die Vorgaben nicht erfüllen, werden sie gefoltert und (zumindest im Um-
erziehungslager Kae’chŏn) tagelang in eine Strafzelle gesperrt, die so klein ist,
dass man weder stehen noch ausgestreckt liegen kann.
Ein Unterschied zu den Internierungslagern ist, dass die Gefangenen nach der
Arbeit noch ideologisch unterwiesen werden und z. B. Reden von Kim Il-sung und
Kim Jong-il auswendig lernen und sich Ritualen von Kritik und Selbstkritik unter-
ziehen müssen.
Viele Insassen der Umerziehungslager haben sich Vergehen schuldig gemacht, die
auch in anderen Staaten der Welt strafbar sind, häufig wurden diese aber aus wirt-
schaftlicher Not heraus begangen, z. B. Diebstahl von Lebensmitteln, Schmuggel
oder unerlaubter Handel.
Es gibt in Nordkorea etwa 15–20 Umerziehungslager. Außer zum Umerziehungs-
lager Nr. 1 Kae’chŏn (ca. 6.000 Gefangene) gibt es auch zu einigen anderen La-
gern Zeugenaussagen von ehemaligen Gefangenen, z. B. zu Umerziehungslager
Nr. 12 Chŏn’gŏri (ca. 2.000 Gefangene), Umerziehungslager Nr. 77 Tanch'ŏn (ca.
7.000 Gefangene), Umerziehungslager Nr. 22 Oro (ca. 1.000 Gefangene), Umer-
ziehungslager Nr. 4 Kangdong (ca. 7.000 Gefangene).
Eine ehemalige Insassin des Umerziehungslagers Kae’chŏn ist die südkoreanische
Menschenrechtlerin Lee Soon-ok.
Staatliche Propaganda
Wie in anderen Diktaturen werden die Menschenrechtsverletzungen durch die
nordkoreanische Staatsführung geleugnet und es existiert eine Reihe von Institu-
tionen, die vor allem gegenüber dem Ausland den Eindruck erwecken sollen,
Nordkorea sei eine demokratische, pluralistische Gesellschaft.
So gibt es ein Parlament (die Oberste Volksversammlung) mit verschiedenen
Parteien (neben der herrschenden Partei der Arbeit Koreas sind dies die Korea-
nische Sozialdemokratische Partei und die Chondoistische Ch’ŏngu-Partei, die
aber nach Berichten über keine regionalen Gliederungen verfügen).
Außerdem gibt es buddhistische Tempel und christliche Kirchen, die vermutlich
dem Zweck dienen, den Anschein von Religionsfreiheit zu erwecken. So wurde die
Bonsoo-Kirche in Pjöngjang eigens 1989 zu den Weltfestspielen der Jugend und
Studenten errichtet, zu denen viele ausländische Besucher erwartet wurden.
Ausländische Besucher und Journalisten dürfen bis auf wenige Ausnahmen nur die
Hauptstadt Pjöngjang und ausgewählte, zu Propagandazwecken dienende Orte un-
ter strenger Bewachung besuchen.
Der Nordkoreanische Außenminister Ri Su-yong erklärte am 1. März 2016, dass
Nordkorea in Zukunft an keiner Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten
Nationen mehr teilnehmen werde, in der es um die Situation in Nordkorea ginge.
Beschlüsse des Gremiums bezüglich Nordkorea wolle das Land in Zukunft nicht
als bedeutungsvoll anerkennen.
Ri warf den USA, Japan und Südkorea vor, dass sie Agenten nach Nordkorea
schicken würden, um dort, wie er sagte ‚Kriminelle‘ als Überläufer anzuwerben,
die nach ihrer Flucht für Geld unbegründete und haltlose Berichte über das Land
produzieren würden.
Internationale Ermittlungen
Im Februar 2014 warf eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen
Nordkorea Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Etliche dieser Verbrechen
seien gegen eine verhungernde Bevölkerung verübt worden; hierzu hätten ein-
jährige Ermittlungen Beweise erbracht. Auch sei es zu Entführungen von Men-
schen aus Japan und Südkorea gekommen. Der Internationale Strafgerichtshof in
Den Haag solle mit der Aufarbeitung der Schuldfrage betraut werden. Die Vertre-
tung Nordkoreas bei den Vereinten Nationen in New York bezeichnete die Be-
schuldigungen als haltlos und erklärte, sie werde diese niemals akzeptieren.
Im November 2014 verglich der UN-Sonderberichterstatter Marzuki Darusman die
Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea mit Verbrechen in der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Es gebe ausreichend Beweise für eine Anklage Kim Jong-uns vor
dem Internationalen Strafgerichtshof. Im Januar 2016 ersuchte Darusman die UN
darum Kim offiziell darüber zu informieren, dass gegen ihn entsprechend dem
Bericht vom November 2014 ein Untersuchungsverfahren wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit aufgenommen werden kann.
Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechtssituation_in_Nordkorea)
dort gibt es weitere Quellenangaben (Stand: Dez.2017)






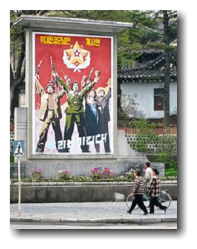
Propagandaplakat








