

Unabhängigkeitsreferendum
in Katalonien 2017
Die Regionalregierung Kataloniens organisierte ein am 1. Oktober 2017
durchgeführtes Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens von
Spanien.
Nach der Volksbefragung von 2014 verfolgte die katalanische Regionalregierung
damit zum zweiten Mal ein Unabhängigkeitsreferendum.
Die spanische Regierung, die die Abstimmung für illegal hält, versuchte die Be-
fragung zu verhindern, u.a. weil die spanische Verfassung keine Abstimmungen
über die Unabhängigkeit einer Autonomen Gemeinschaft vorsieht. Die katala-
nische Unabhängigkeitsbewegung hingegen stützt ihre Position auf das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker.
Die katalanische Gesellschaft gilt in der Frage der Unabhängigkeit als tief ge-
spalten. Ein Referendum war ein zentrales Wahlversprechen der Siegerparteien der
Regionalwahlen von 2015, das Wahlbündnis Junts pel Sí, bestehend aus CDC,
ERC und Moviment d’Esquerres (MES) sowie mit einer eigenen Liste die links-
extreme CUP.
Für den Fall, dass sich eine Mehrheit der Teilnehmer des Referendums für die
Unabhängigkeit Kataloniens ausspricht, hatte die katalanische Regionalregierung
zuvor angekündigt, innerhalb von 48 Stunden die Sezession von Spanien und
damit die Unabhängigkeit auszurufen.
Nach der umstrittenen Abstimmung meldeten die katalanischen Behörden eine
Wahlbeteiligung von 42,3 % sowie eine Zustimmung von rund 90 % der Wähler
zu einer Unabhängigkeit.
Kontext und Vorgeschichte
Seit 1979 hat die Region Katalonien den Status einer Autonomen Gemeinschaft in
Spanien. Die Autonomen Gemeinschaften sind in ihrer Kompetenzausstattung mit
den deutschen Bundesländern vergleichbar und verfügen auch über weitreichende
Gesetzgebungszuständigkeiten. Allerdings handelt es sich bei ihnen nicht um
Gliedstaaten, da Spanien kein Bundesstaat ist.
Die politischen Institutionen Kataloniens sind unter dem traditionellen Namen
Generalitat de Catalunya zusammengefasst und umfassen das Regionalpar-
lament (Parlament de Catalunya), den von diesem gewählten Ministerpräsi-
denten (President de la Generalitat) und die von diesem gebildeten Regierung
(Govern).
Autonomiestatut von 2006
Unter der Regierung des Bündnisses aus PSC, ERC und ICV wurde ein neues
Autonomiestatut für Katalonien ausgearbeitet. Das Autonomiestatut hat für Kata-
lonien den Rang einer Regionalverfassung, und das Autonomiestatut von 2006
sollte die bestehende Autonomie Kataloniens ausweiten und die Beziehungen zum
spanischen Zentralstaat neu regeln.
In der Volksabstimmung vom 18. Juni 2006 sprachen sich 73,9 % der Wähler (bei
einer Abstimmungsbeteiligung von 49 %) für das neue Statut aus. Der Text war
durch das spanische Parlament erst nach teils gravierenden Änderungen bestätigt
worden. Nach Unterzeichnung durch König Juan Carlos I. trat das Gesetz am 9.
August 2006 in Kraft.
Die rechtskonservative Volkspartei (PP) lehnte das neue Autonomiestatut ab und
klagte dagegen vor dem spanischen Verfassungsgericht. Nach einem vierjährigen
Verfahren erklärte das Verfassungsgericht am 28. Juni 2010 das Autonomiestatut
in 14 von 223 Bestimmungen für verfassungswidrig.
Die fehlende Bereitschaft der spanischen Regierung, nach der Blockade der
Reform des Autonomiestatuts auf eine Verhandlungslösung für die zugrundelie-
genden Konflikte im Verhältnis des spanischen Staats zur autonomen Gemein-
schaft Katalonien hinzuarbeiten, wird als ein wesentlicher Auslöser für die
zunehmende Verschärfung der Situation gesehen.
Referenden zur Unabhängigkeit Kataloniens 2009–2011
In der Zwischenzeit hatten sich durch die spanische Wirtschaftskrise ab 2007 die
Beziehungen der spanischen Regierung zum wirtschaftsstarken Katalonien zuneh-
mend angespannt.
Der Umstand, dass Katalonien bei einem Bevölkerungsanteil von 15 % fast ein
Viertel des spanischen BSP erwirtschaftet und jährlich große Teile der Steuer-
einnahmen in den spanischen Zentralhaushalt und in andere Regionen abführt, und
der Eindruck einer spanischen Blockadehaltung führen, seit sich das Gerichtsver-
fahren zum Autonomiestatut in die Länge zu ziehen begann, zu einer immer
stärkeren Unzufriedenheit.
Von 2009 bis 2011 wurden in insgesamt 553 der damals 947 katalanischen Städte
und Gemeinden Referenden zur Unabhängigkeit Kataloniens durchgeführt. Diese
waren nicht bindend und erreichten nur geringe Wahlbeteiligungen, es sprach sich
aber eine große Mehrheit der Befragten für die Unabhängigkeit aus.
Volksbefragung über die politische Zukunft Kataloniens 2014
Bei den Regionalwahlen 2010 und 2012 wurde das Thema der Unabhängigkeit
Kataloniens zunehmend Teil des Wahlkampfes. Aus beiden Wahlen ging die CiU
unter Artur Mas als Sieger hervor, musste jedoch Minderheitsregierungen unter
Tolerierung durch andere katalanische Parteien bilden.
Am 12. Dezember 2013 kündigte Artur Mas gemeinsam mit Vertretern der
Parteien CiU, ERC, ICV-EUiA und CUP an, am 9. November 2014 eine Volks-
befragung durchführen zu wollen.
Die Fragestellung lautete: „Wollen Sie, dass aus Katalonien ein Staat wird?“ Wer
diese Frage mit „ja“ beantwortete, sollte sich noch zu einer zweiten Frage äußern,
nämlich: „Wollen Sie, dass dieser Staat unabhängig ist?“
Das spanische Verfassungsgericht erklärte daraufhin am 25. März 2014 zunächst
die der Volksbefragung zugrundeliegende Resolution über den Charakter des
Volkes von Katalonien als eines souveränen politischen und rechtlichen Subjekts
für verfassungswidrig.
Am 29. September 2014 nahm es darüber hinaus einen Normenkontrollantrag der
spanischen Regierung über das Dekret zur Durchführung einer nicht-referendiellen
Volksbefragung an und setzte das Dekret damit aus. Auch die von der Regional-
regierung daraufhin vorgesehene Durchführung einer alternativen Befragung wur-
de vom spanischen Verfassungsgericht am 4. November 2014 ausgesetzt.
Die Volksbefragung wurde am 9. November 2014 dennoch durchgeführt. Bei einer
Beteiligung von geschätzt einem Drittel der Wahlberechtigten sprachen sich 80,76
% mit einem „Ja“ für beide Fragen, also für die Unabhängigkeit aus. Da es auf-
grund der fehlenden gesetzlichen Grundlage kein Wählerverzeichnis gab, konnte
die Abstimmungsbeteiligung nicht genau ermittelt werden.
2017 wurde Artur Mas, gemeinsam mit mehreren anderen Regionalpolitikern,
wegen der Durchführung der Volksbefragung zu einer Geldstrafe verurteilt. Des
Weiteren wurde ihm für zwei Jahre untersagt, politische Ämter zu bekleiden.
Parlamentswahl in Katalonien 2015
Im Juni 2015 lösten die beiden katalanisch-bürgerlichen Parteien CDC und UDC
ihr seit 1979 bestehendes Parteienbündnis Convergència i Unió (CiU) auf, weil die
UDC eine einseitige Unabhängigkeitserklärung und die Abhaltung eines nicht von
der spanischen Verfassung gedeckten Referendums ablehnte.
Nachdem sich die CDC von Ministerpräsident Mas mit der rivalisierenden ERC
auf eine gemeinsame Kandidatur unter dem Namen Junts pel Sí („Zusammen für
das Ja“) verständigt hatte, setzte Mas die Neuwahlen für den 27. September 2015
an. Ein zentrales Wahlversprechen von Junts pel Sí war die Durchführung eines
Unabhängigkeitsreferendums binnen 18 Monaten.
Bei der Wahl am 27. September 2015 entfielen auf die für eine Unabhängigkeit
Kataloniens eintretenden Kandidaturen Junts pel Sí (39,6 %) und CUP (8,2 %)
insgesamt 47,8 % der Stimmen. Dieses Ergebnis reichte jedoch für 72 Sitze (Junts
pel Sí 62, CUP 10) und damit eine Mehrheit im Regionalparlament, das insgesamt
über 135 Sitze verfügt.
In seiner Sitzung vom 9. November 2015 verabschiedete das katalanische Parla-
ment mit den Stimmen von Junts pel Sí und CUP und gegen die Stimmen aller
übrigen Fraktionen eine „Resolution über den Beginn des politischen Prozesses in
Katalonien als Folge des Wahlergebnisses vom 27. September 2015“.
In dieser Resolution heißt es u.a., dass das Parlament den Beginn des Prozesses der
Schaffung eines unabhängigen Staats und der Einleitung eines verfassungsgeben-
den Verfahrens proklamiert.
Besonders brisant ist weiter die Passage, nach der das Parlament erklärt, dass es
sich „als Wahrer der Souveränität und als Ausdruck der verfassungsgebenden
Gewalt“ in dem Prozess der „demokratischen Loslösung vom spanischen Staat“
Entscheidungen von dessen Institutionen und insbesondere des Verfassungs-
gerichts nicht unterwerfen werde.
Die Zentralregierung in Madrid reichte gegen die Resolution des Parlaments vom
9. November 2015 Verfassungsklage ein. Mit Urteil vom 2. Dezember 2015 gab
das Verfassungsgericht der Klage statt und erklärte diese Parlamentsresolution für
verfassungswidrig und nichtig.
Soweit die Vorgeschichte des Unabhängigkeitsreferendums laut Wikipedia.
Und wie verlief das umstrittene Referendum am 1.10.2017 ?
Tag des Referendums
Da aufgrund der angekündigten Gegenmaßnahmen der spanischen Behörden
absehbar war, dass vermutlich nicht alle Abstimmungslokale geöffnet oder über
den ganzen Tag geöffnet gehalten werden könnten, teilte der katalanische Regier-
ungssprecher kurz vor Beginn der Abstimmung mit, dass man ein digitales Wäh-
lerverzeichnis eingerichtet habe. Somit könne jeder Abstimmungsberechtigte in
jedem beliebigen Abstimmungslokal seine Stimme abgeben. Mittels des digitalen
Wählerverzeichnisses werde sichergestellt, dass jeder Stimmberechtigte nur einmal
wählen könne.
Bei diesem Verfahren kam es zeitweise zu Problemen. Zum einen weil die spani-
schen Behörden versuchten, technologische Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zum
anderen, weil in vielen Abstimmungslokalen die Internetverbindung aufgrund der
hohen Zahl der Wartenden schlecht war, sodass diese aufgefordert wurden, ihre
Mobiltelefone in den „Flugzeugmodus“ zu versetzen.
Die katalanische Regionalpolizei Mossos d’Esquadra kam dem Befehl der Zentral-
regierung, Wahllokale abzuriegeln, nicht nach und blieb passiv.
Regionalpolizei und Feuerwehr stellten sich zum Teil schützend vor die Bevöl-
kerung. Gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter wurden deshalb die
nationale Polizei und die Guardia Civil eingesetzt.
Die Polizei beschlagnahmte einige Wahlurnen und Stimmzettel. Dabei durch-
brachen die Beamten Menschenketten, die sich gebildet hatten, und es kam zu
Handgreiflichkeiten. Polizeieinheiten in Stoßtrupp-Ausrüstung gingen mit Tritten,
Gummigeschossen und Schlagstöcken gegen Bürger vor.
Das katalanische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass 893 Personen bei
Zusammenstößen mit der Polizei verletzt wurden. Es befanden sich am Folgetag
noch vier im Krankenhaus, davon zwei in ernstem Zustand. Kataloniens
Regierungschef Puigdemont verurteilte den Polizeieinsatz als unverantwortlich
und als Schande, die Gewalt seitens des spanischen Staates werde die Katalanen
aber nicht aufhalten.
Die Gewalt blieb jedoch insgesamt isoliert. Laut Generalitat de Catalunya seien
400 Wahllokale mit 770.000 Wählern von Schließungen betroffen gewesen.
Mehrere tausend andere Wahllokale waren offen: eine Mehrheit der Bevölkerung
konnte wählen.
Ergebnis
Die Generalitat de Catalunya teilte als vorläufiges Wahlergebnis mit: 2.020.144
(90,09 %) Ja-Stimmen, 176.565 (7,87 %) Nein-Stimmen, 45.568 (2,03 %) leere
Stimmzettel und 20.129 (0,89 %) ungültige Stimmen. Die ungültigen Stimmen
seien hierbei für die Berechnung der Anteile von Ja- und Nein-Stimmen, sowie der
leeren Stimmzettel nicht berücksichtigt worden.
2.262.424 von 5.313.000 wahlberechtigten Katalanen hätten eine gezählte Stimme
abgeben können. Dies entspricht 42,5 %. Laut Schätzungen hätten 770.000 Bürger-
innen und Bürger nicht abstimmen können; dies entspreche 14,5 % der Wahlbe-
rechtigten.
Gleichzeitig berichteten spanische Medien von zahlreichen Unregelmässigkeiten
beim Wahlablauf: so sei es ohne weiteres möglich gewesen, mehrfach abzustim-
men oder ohne jeglichen Ausweis teilzunehmen; gewisse Wahlbezirke hätten so
mehr Stimmabgaben als gemeldete Wähler; insgesamt sei es schwer zu wissen,
wieviele Wähler tatsächlich an der Abstimmung teilgenommen hätten.
Reaktionen im Vorfeld zur Abhaltung des Referendums
Internationale Organisationen
Europäische Union: Am 7. September sagte Antonio Tajani, der Präsident
des Europäischen Parlaments, in einem Schreiben an die spanische EU-
Parlamentsabgeordnete Beatriz Becerra, dass die verfassungsmäßige
Ordnung jedes EU-Mitgliedsstaats zu achten sei und dass, wenn sich ein
Gebiet von einem EU-Mitgliedsstaat abspalte, die EU-Verträge dort erst
einmal nicht gelten.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte am 14.
September, dass die EU den Entscheidungen des spanischen
Verfassungsgerichts und Parlaments folgen werde. Die EU werde ein Ja-
Votum in der Volksabstim-mung respektieren, jedoch könne Katalonien
nicht darauf hoffen, sofort nach der Abstimmung zu einem selbständigen
EU-Mitgliedsstaat zu werden.
-
Europarat: Der Europarat gab auf eine Anfrage von Carles Puigdemont hin
im Juni 2017 bekannt, eine Volksabstimmung sei nur unter strenger Ein-
haltung der spanischen Verfassung durchzuführen.
-
Vereinte Nationen UNO: Die Vereinten Nationen haben eine Beteiligung
als Wahlbeobachter abgelehnt.. Generalsekretär Ban Ki Moon hatte bereits
2015 in einem Interview geäußert, dass aus seiner Sicht sich Katalonien
nicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen könne, da es
bereits über Autonomie innerhalb des spanischen Staates verfüge.
Staaten
-
Vereinigte Staaten: Am 13. April gab die US-Botschaft in Madrid bekannt,
dass die Vereinigten Staaten die Frage der katalanischen Unabhängigkeit als
eine innere Angelegenheit Spaniens betrachten.[45]
-
Frankreich: Am 16. Juni bezeichnete der französische Präsident Emmanuel
Macron die Frage der katalanischen Unabhängigkeit als eine innere
Angelegenheit Spaniens.[46]
-
Deutschland: Am 8. September gab Regierungssprecher Steffen Seibert an,
dass die Bundesregierung an der Stabilität Spaniens interessiert sei und dass
es hierfür erforderlich sei, geltendes Recht und die spanische Verfassung auf
allen Ebenen zu beachten. Ähnlich hatte sich die Bundesregierung bereits
2015 geäußert.
-
Ungarn: Am 18. September kündigte Zoltán Kovács, der Sprecher von
Präsident Viktor Orbán, an, den „Willen des Volkes respektieren“ zu
wollen. Gleichzeitig bezeichnete er die Unabhängigkeitsfrage als „innere
Angelegenheit von Spanien und Katalonien“. Zur Frage, ob die ungarische
Regierung im Fall eines positiven Ausgangs des Referendums die Unab´-
hängigkeit Kataloniens anerkennen werde, äußerte er sich nicht.
Zum Verlauf und zum Ergebnis
Die EU-Kommission bezeichnete das Referendum am 2. Oktober als nicht
legal. Auch im Falle einer legalen Abstimmung für die Unabhängigkeit
würde das Gebiet Kataloniens jedoch aus der EU ausscheiden. Gewalt kön-
ne kein Mittel der Politik sein. Jean-Claude Juncker wertete die Ausei-
nandersetzungen als innenpolitische Angelegenheit Spaniens. Die Kom-
mission mahnte zudem Gespräche zwischen den Beteiligten an.
Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngigkeitsreferendum
_in_Katalonien _2017), dort gibt es weitere Quellenangaben, Stand 5.10.2017
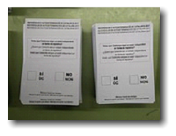
Stimmzettel zum
Referendum











